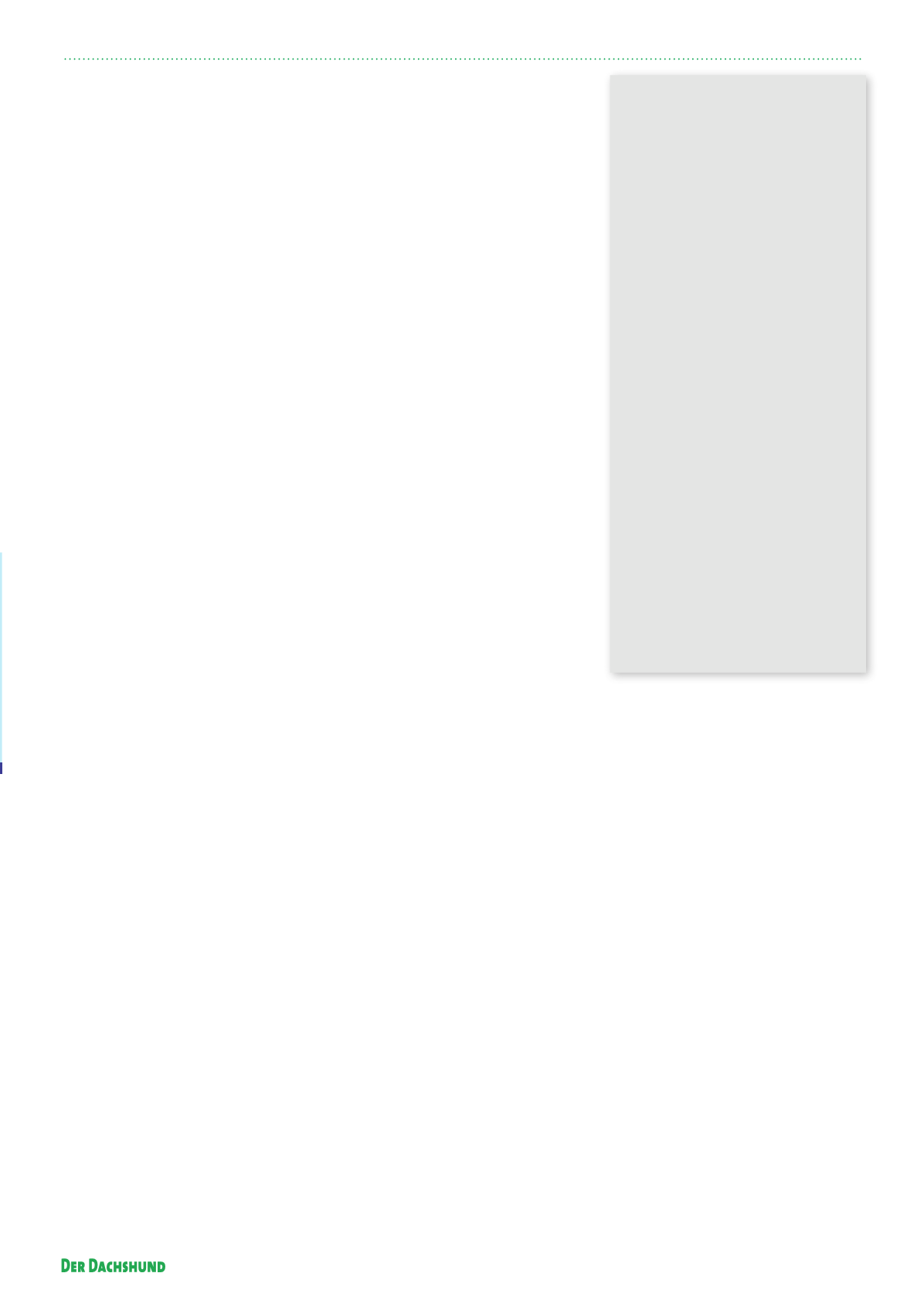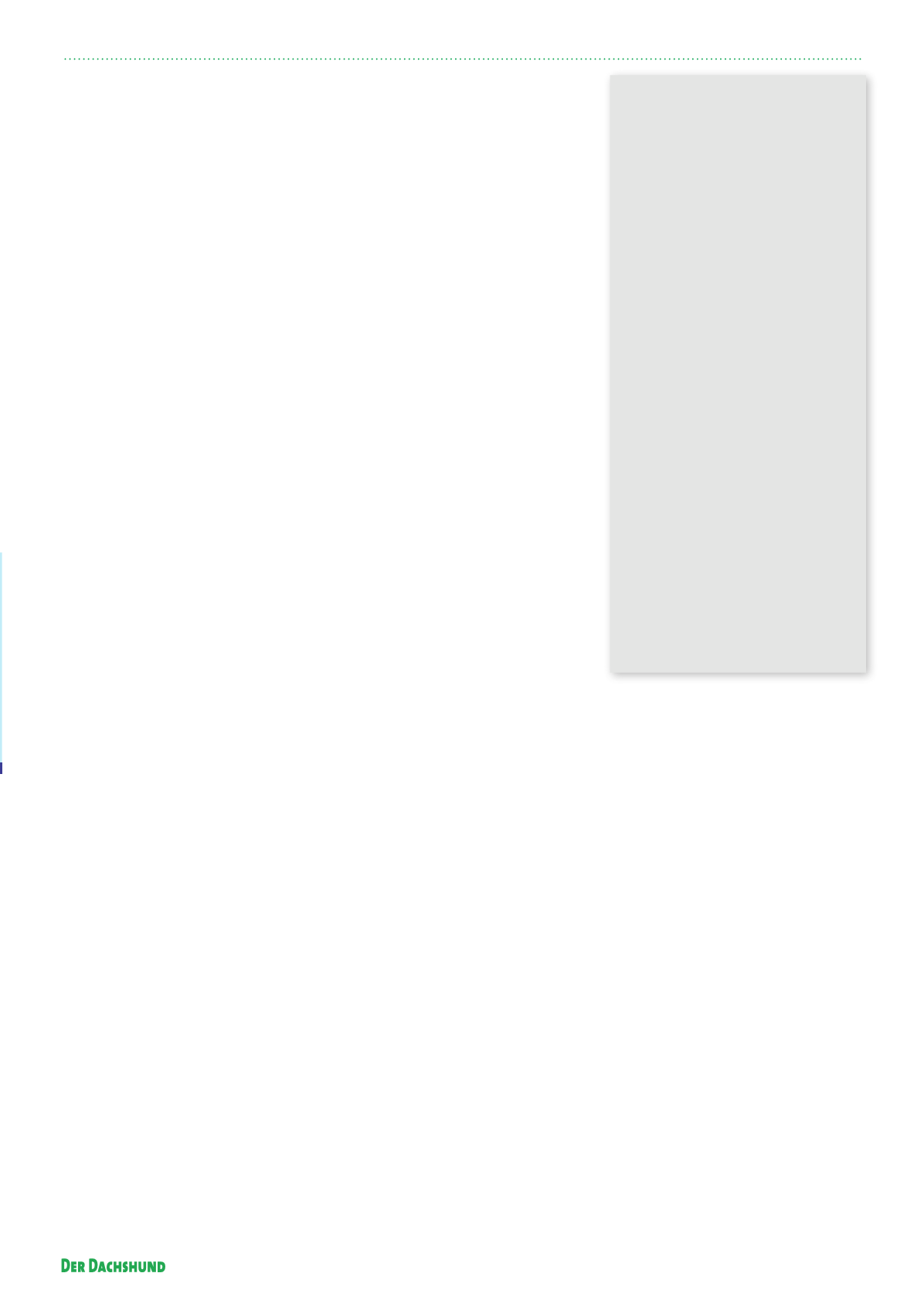
|
6 · 2019
123
Teckel
&
Jagd
Test unter Feldbedingungen auch das leis-
tet, was er verspricht. „Unabhängig“ heißt
in diesem Zusammenhang, dass die im
Rahmen der Validierung untersuchten
Tiere nicht aus demselben Kontingent
stammen dürfen, wie jene, an denen die
primäre Mutationssuche durchgeführt
wurde. Jedes Testverfahren wird durch
seine Sensitivität und Spezifität charakteri-
siert. Dabei gibt die Sensitivität den Anteil
der Merkmalsträger an, der vom Test
erkannt wird, während die Spezifität dem
Anteil der Tiere ohne Merkmal entspricht,
die vom Test richtigerweise als Nicht-Träger
erkannt werden. Beide Kenngrößen sind
wichtig und müssen im Rahmen der Vali-
dierung ermittelt werden. So mag ein Ver-
fahren mit 95 Prozent Sensitivität auf den
ersten Blick sehr gut erscheinen, da es 95
von 100 Tieren erkennt, die das Zielmerk-
mal aufweisen, also z. B. später erkranken
werden. Beträgt aber die Spezifität des
Tests z. B. nur 70 Prozent, so würden 30 von
100 Tieren, die das Merkmal nicht aufwei-
sen, also später nicht erkranken, vom Test
falsch eingestuft. Dies stellt insbesondere
dann ein Problem dar, wenn „falsch posi-
tive“ Ergebnisse zu drastischen Konsequen-
zen für Tier oder Halter führen.
Dr. Heydeck:
Wie viele Probanden werden
für die Entwicklung eines Tests und seine
Validierung benötigt?
Dr. Manz:
Die erforderliche Anzahl von Pro-
banden hängt von zwei Dingen ab:
1. der diagnostischen Trennschärfe des
Tests (d. h., wie gut unterscheidet der Test
erwartungsgemäß zwischen Trägern und
Nicht-Trägern des Merkmals?) und
2. der gewünschten Präzision der Validie-
rung (d. h., wie genau sollen Sensitivität
und Spezifität geschätzt werden?). Geht es
z. B. um einen DNA-Test zur Bestimmung
des Geschlechts von Küken, so ließe sich
ein solcher Test mit den heute verfügbaren
Methoden einfach und ohne großen Auf-
wand realisieren. Es gibt hinreichend viele
DNA-Abschnitte, die für das jeweilige
Geschlecht charakteristisch sind, und ein
DNATest ließe sich anhand weniger Tiere
im Labor etablieren. Für die Validierung
reicht dann Untersuchungsmaterial von,
sagen wir, 10 Tieren pro Geschlecht aus,
das ich mir von anderen Zuchtbetrieben
geben lasse und auf das ich meinen Test
anwende. Durch den Vergleich mit dem
morphologischen Geschlecht ließen sich
Sensitivität und Spezifität des Tests hinrei-
chend genau ermitteln, da beide im Fall
von
DNA-basierten
Verfahren
zur
Geschlechtsbestimmung
100
Prozent
betragen sollten. Komplizierter wird es,
wenn das Zielmerkmal von einer Vielzahl
von DNA-Abschnitten bestimmt wird. Um
ggf. auch deren Wechselwirkungen
berücksichtigen zu können, müsste das
Suchkontingent alle möglichen Kombinati-
onen der Mutationen mit einer Häufigkeit
abbilden, die groß genug für das Erkennen
bzw. die Beurteilung ihres Einflusses ist. Da
kann der Bedarf an Probanden schnell in
die Tausende gehen. Weil das in der
Humanforschung nicht anders ist, wurde
dort übrigens in 2018 das erste Eine-Millio-
nen-Genome-Projekt gestartet.
Dr. Heydeck:
Sind Gentests für alle Rassen
oder eine Rasse in allen Ländern anwendbar?
Dr. Manz:
Dies zu klären, ist eine wesentli-
che Teilaufgabe der Validierung.
Dr. Heydeck:
An der TiHo Hannover wurde
mit Unterstützung des SV ein „HD-Test“ ent-
wickelt. Wie sollte dieser Test das individu-
elle Risiko an HD zu erkranken vorhersagen?
Dr. Manz:
Die Suche nach DNA-Markern
für HD ergab 17 Stellen („Marker“) im
Genom, die, anschließend als „mit HD
assoziiert“ in einer Fachzeitschrift veröf-
fentlich wurden. Laut Beschreibung des
Testverfahrens, die sich übrigens nur in der
Patentschrift zum Test findet, wird der
Genotyp jedes einzelnen Markers in
Abhängigkeit von der jeweiligen Anzahl
von HD-Allelen, als Risiko „steigernd“ oder
„senkend“ klassifiziert. Mithilfe eines spe-
ziellen Rechenverfahrens, das ebenfalls
Bestandteil des Patentes ist, trägt jeder
Genotyp dann seinen Teil zum numeri-
schen Gesamtstatus der 17 Marker bei.
Aus dieser Zahl können dann das individu-
elle HD-Risiko und daraus wiederum der
„genomische Zuchtwert für HD“ des Tieres
mathematisch hergeleitet werden.
Dr. Heydeck:
Wie haben Sie die Vorhersage-
kraft und Nützlichkeit des Tests überprüft?
Dr. Manz:
Die beteiligten Züchter erfass-
ten für uns Welpen im Alter von ca.
8 Monaten, unabhängig von jeglicher Vor-
klassifizierung. Über einen Zeitraum von
mindestens 15 Monaten haben sie dann
per Online-Fragebogen diverse Umweltpa-
rameter sowie das Fütterungsregime, Imp-
fungen und spezielle Erkrankungen doku-
mentiert. Nach Erreichen des entsprechen-
den Alters wurde dann der HD-Status der
Tiere, wie üblich, durch die Auswertung
von Röntgenbildern bestimmt. Gleichzeitig
erhielten alle Tiere den „HD-DNA-Test“
gemäß den Anweisungen im Patent. Die
Vorhersagekraft des DNA-Tests ergab sich
dann aus dem Vergleich der individuellen
Risikobewertung und dem klinischen
Befund der Röntgenuntersuchung.
Dr. Heydeck:
Ist der Test zur Einschätzung
des individuellen Risikos an HD zu erkran-
ken geeignet?
Dr. Manz:
Nein! Führt man den Test so
durch, wie in der Patentschrift beschrie-
ben, dann ist er zur Einschätzung des indi-
viduellen HD-Risikos ungeeignet .
Dr. Heydeck:
Gibt es einen Zusammenhang
mit der Haltung oder der Ernährung der
Hunde?
Dr. Manz:
Als wir die Röntgenbefunde zu
HD (und ED) mit den einzelnen Umweltpa-
rametern verglichen haben, zeigten sich
nur schwache Zusammenhänge. Man kann
derzeit also nicht sagen, dass diese oder
jene Haltungsform, oder diese oder jene
Ernährungsweise, eher zu HD (bzw. ED)
führt als eine andere.
Dr. Heydeck:
Wie schätzen Sie die Sinnhaf-
tigkeit genomischer Zuchtwerte für kom-
plexe Krankheiten ein, die auf der Basis von
Daten nahe verwandter Tiere beruhen?
Dr. Manz:
Genomische Zuchtwerte finden
ihre Anwendung in der Nutztierzucht.
Dazu werden Tiere an zahlreichen DNA-
Markern genotypisiert, von denen man
weiß, dass sie statistisch mit den ange-
strebten Merkmalswerten (z. B. Milchleis-
tung) zusammenhängen. Unter der
Annahme, dass dieser statistische Zusam-
menhang auch all jene Erbanlagen
umfasst, die kausal zu den angestrebten
Dr. Eberhard Manz
ist geschäfts-
führender Gesellschafter der Gene-
ratioSol.GmbH, Heidelberg.
Nach dem Studium der Veterinär-
medizin in Berlin, erfolgten die Pro-
motionsarbeiten am Institut für
Humangenetik der Med. Hoch-
schule Hannover (Prof. Schmidtke),
die Dissertation wurde eingereicht
über das Institut für Tierzucht der
TiHo Hannover (Prof. Simon). Die
sich anschließende Tätigkeit als
wiss. Mitarbeiter in der Tierklinik
für Fortpflanzung der Freien Uni-
versität Berlin wurde mit Prüfung
zum der Fachtierarzt abgeschlos-
sen. Es folgte der Wechsel an das
Institut für Umwelt- und Tierhygi-
ene der Universität Hohenheim, wo
1999 im Rahmen der Gründungsin-
itiative der Schritt in die Selbst-
ständigkeit erfolgte. Das eigene
Labor besteht seit 2001 und hat
den Schwerpunkt DNA-Programme
zur Bestimmung von Identität,
Abstammung und Eigenschaften/
Erbkrankheiten. Neben der Routi-
nediagnostik erfolgt Beratungstä-
tigkeit zu genetischen Fragestellun-
gen sowie die Bereitstellung von
Online-Lösungen zur Durchführung
von Feldstudien.