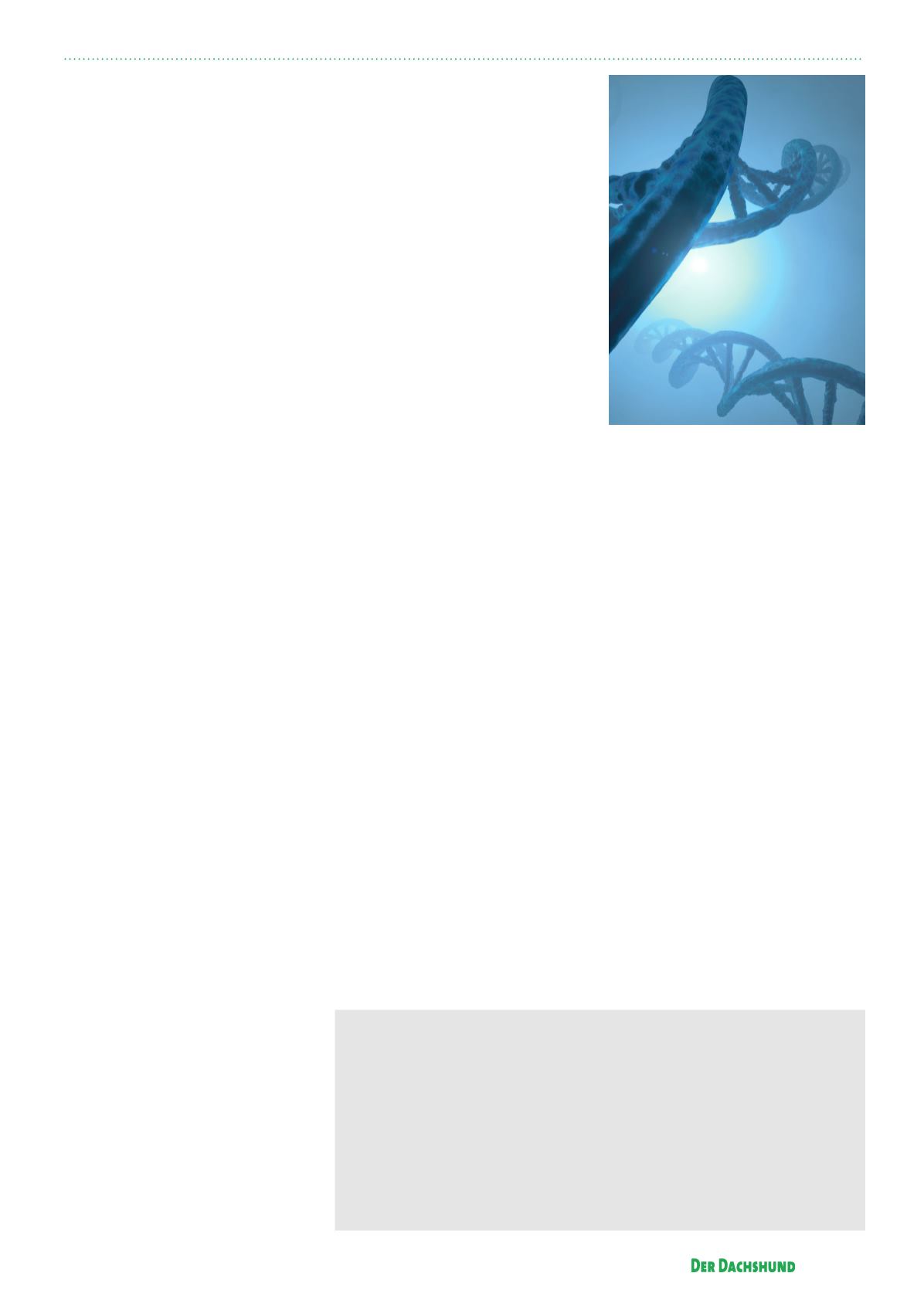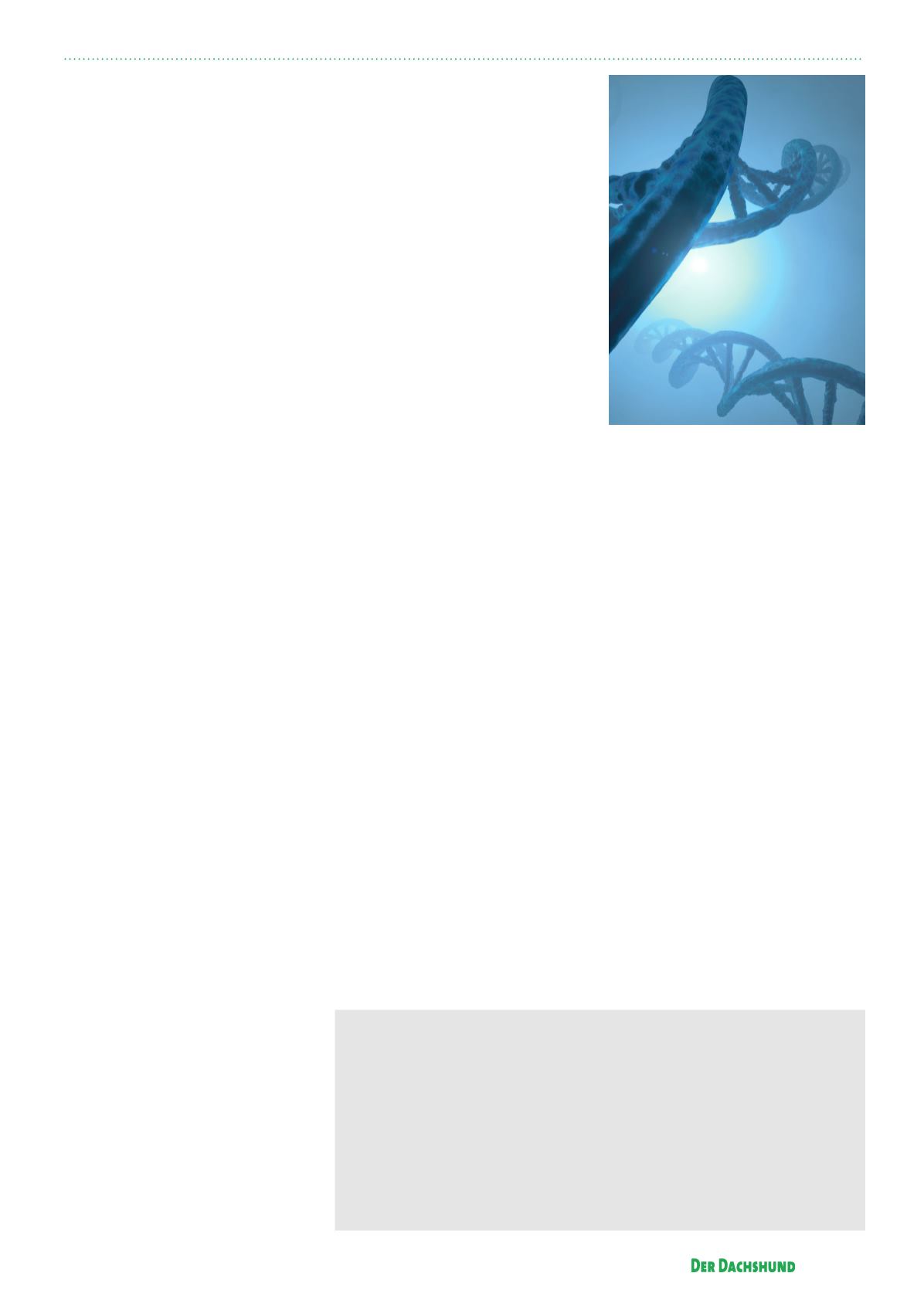
Teckel
&
Jagd
124
|
6 · 2019
Merkmalswerten führen, macht die Aus-
richtung der Zucht an genomischen Zucht-
werten (ggf. unter Einschluss der elterli-
chen Zuchtwerte und individueller Leis-
tungsparameter) durchaus Sinn. Vorsicht
ist jedoch geboten, wenn es um die indivi-
duelle Voraussage komplexer Krankheiten
geht, ohne dass bekannt ist, in welcher
Weise die untersuchten DNA-Marker an
Entstehung und Verlauf der Krankheiten
beteiligt sind. Der von uns untersuchte HD-
Test fällt in diese Kategorie. Wie der Name
schon sagt, wirken bei „komplexen“ Krank-
heiten zahlreiche Faktoren zusammen.
Dazu gehören neben genetischen Veranla-
gungen auch Umweltparameter wie z. B.
Ernährung und Bewegung. Die Kombinati-
onsmöglichkeiten genetischer und nicht-
genetischer Risikofaktoren sind dabei aber
so vielfältig, dass jede Stichprobe immer
nur Teilaspekte abbilden kann. Besteht
meine Stichprobe z. B. nur aus nahe ver-
wandten Tieren, so lässt sich daran zwar
der Vererbungsmechanismus der Krank-
heit gut untersuchen, die Daten liefern
aber nur einen sehr eingeschränkten Blick
auf die Gesamtpopulation zukünftiger
Testnehmer. Bei dieser Ausgangslage ist es
nicht verwunderlich, dass es bisher keine
verlässlichen DNA-Tests für komplexe
Krankheiten gibt – weder beim Tier noch
beim Menschen. Risikobewertungen, die
sich auf die Analyse einer Handvoll von
DNA-Markern stützen, muss man also, wie
der Fall des HD-Tests zeigt, mit Skepsis
begegnen.
Dr. Heydeck:
Welche Vorgehensweise emp-
fehlen Sie Vereinen, die einen Gentest zur
züchterischen Selektion einsetzen möchten?
Dr. Manz:
Zunächst sollten für jedes propa-
gierte Testverfahren die zugehörigen Pub-
likationen sorgfältig geprüft werden. Wis-
senschaftler begnügen sich oft mit der
Veröffentlichung der von ihnen gefunde-
nen statistischen Assoziationen und belas-
sen es bei dem Verweis darauf, dass sich
daraus vielleicht ein Verfahren zur indivi-
duellen Risikobewertung entwickeln ließe.
Der Fall des HD-Tests zeigt aber, wie wich-
tig eine unabhängige Überprüfung der
Leistungsfähigkeit solcher Verfahren ist.
Die zentrale Frage lautete: „Hält der ange-
botene Test, was er verspricht?“ Für die
Beurteilung der Aussagekraft eines Test-
verfahrens gibt es klare Regeln. Wie mit
den Ergebnissen umgegangen wird, steht
jedoch auf einem anderen Blatt. Ein Nega-
tivbeispiel liefert in diesem Zusammen-
hand der SOD1-Mutationstest für Degene-
rative Myelopathie (DM) bei Hunden. Die
SOD1-Mutation wurde schon 2009 als DM-
assoziiert beschrieben (Awano et al., 2009),
allerdings mit der klaren Einschränkung,
dass diese Mutation allein das Krankheits-
geschehen nicht erklären kann. Die klini-
sche DM ist mit einer mittleren Prävalenz
von 0,19 Prozent äußerst selten. Sie tritt im
Durchschnitt erstmals im Alter von 9 Jah-
ren auf, und es bedarf des Hinzutretens
weiterer Faktoren zur Auslösung der Symp-
tome, die dann denen bei orthopädischen
oder neurologischen Erkrankungen der
Wirbelsäule gleichen. Der Mutationsnach-
weis wurde patentiert, ohne dass Untersu-
chungen zu seiner Aussagekraft veröffent-
licht worden waren. Nach wie vor kann
nämlich die Diagnose DM nur nach einer
histologischen
Untersuchung
sicher
gestellt werden. Im Auftrag des SV haben
Professor Krawczak und ich auch die von
Awano et al. (2009) gemachten Angaben
sowie die Ergebnisse einer großen Popula-
tionsstudie von Zeng et al. (2014) bewer-
tet. Zeng und Mitarbeiter hatten bei der
Untersuchung von mehr als 33.000 zufälli-
gen Probanden aus einer Vielzahl von Ras-
sen den reinerbigen Genotyp der Risiko-
mutation bei 24 Prozent der Tiere gefun-
den. Den mischerbig heterozygoten Geno-
typ wiesen 27 Prozent auf, 49 Prozent
waren reinerbig frei von der Risikomuta-
tion. Von 168 histologisch positiv für DM
diagnostizierten Tieren, trugen 157 (93,5
Prozent) reinerbig die Risikomutation, zwei
(1,1 Prozent) waren reinerbig frei von der
Mutation und neun (5,4 Prozent) waren
heterozygote Träger. Daraus ergibt sich,
dass ein Tier mit reinerbiger Mutation ein
45,6-fach höheres DM-Risiko als andere
Tiere. Das klingt beeindruckend, doch ein
Blick auf das absolute Krankheitsrisiko
relativiert den dramatischen Eindruck die-
ser Zahl. Aus den angegebenen Häufigkei-
ten ergibt sich nämlich mit ein wenig Rech-
nerei, dass lediglich 74 von 10.000 reiner-
big für die Mutation getesteten Tieren an
klinischer DM erkranken werden, vergli-
chen mit 1,6 von 10.000 reinerbig frei oder
als Mutationsträger getesteten Tieren.
Dies sind nüchterne Zahlen, und wie damit
umzugehen ist, muss jeder Verein für sich
entscheiden. Soll unter allen Umständen
das Auftreten reinerbiger Mutationsträger
unterbunden werden? Das würde die
Zuchtpopulation um die Hälfte reduzieren,
Inzucht erhöhen und damit vermutlich zu
neuen Problemen führen. Oder soll das
gelegentliche Auftreten einer DM als eine
der im Alter möglichen Erkrankungen
akzeptiert werden? Leider ist inzwischen
die Situation eingetreten, dass der SOD1-
Mutationstest aus Unkenntnis der Hinter-
gründe „seine eigene Krankheit“ erschaf-
fen konnte. Tierbesitzer setzen den Test
zur Eigendiagnostik ein, Tierärzte betrei-
ben damit Differentialdiagnostik. Passen
Alter und Symptome zusammen, und liegt
Reinerbigkeit für die SOD1-Mutation vor,
so führt dies zur Diagnose „DM“. Der Test
wird also wie bei einem monogenen Merk-
mal eingesetzt, was aufgrund der enor-
men Häufigkeit der Mutation bedeutet,
dass aus einer seltenen Erkrankung eine
häufige geworden ist.
Das Interview führte
Dr. Dagmar Heydeck.
Sie hat
Biologie studiert (Dipl.-Biol.) und in
Biochemie/Molekularbiologie
promoviert (Dr. rer. nat.).
Sie ist Vorsitzende des
Wissenschaftlichen Beirats im
VDH und im Redaktionsbeirat des
„Der Jagdgebrauchshund“.
Seit 1984 führt sie DK und
hat seit 1989 den Jagdschein.
Erschienen ist der Artikel in
„Der Jagdgebrauchshund“
Ausgabe 4/2019
Weiterführende Literatur:
Prospective evaluation of a patented DNA test for canine hip dysplasia (CHD).
Manz E, Tellhelm B, Krawczak M. PLoS One. 2017 Aug 3;12(8): e0182093.
doi: 10.1371/journal. pone. 0182093. eCollection 2017. Awano, T., Johnson, G. S.,
Wade, C. M., Katz, M. L., Johnson, G. C., Taylor, J. F., . . . Coates, J.R. (2009).
Genome-wide association analysis reveals a SOD1 mutation in canine degenerative
myelopathy that resembles amyotrophic lateral sclerosis.
Proceedings of the National Academy of Sciences, 106(8), S. 2794–2799. Zeng, R.,
Coates, J., Johnson, G., Hansen, L., Awano, T., Kolicheski, A., . . . Johnson, G. (Mar 2014).
Breed Distribution of SOD1 Alleles Previously Associated with Canine Degenerative
Myelopathy.
J Vet Intern Med., 28(2), S. 515–21.
Fotos: Pixabay